Das große Jammern über die chronische Unterfinanzierung des Gesundheitswesens hilft wohl wenig; mehr Geld ist nicht zu erwarten. Während die Vergütungen staatlich festgelegt werden, steigen die Betriebskosten seit Jahren überproportional.
 Da die Tarifsteigerungen somit regelmäßig über den Vergütungssätzen liegen, führt dies zu entsprechend geringeren Gewinnmargen oder gar zu Verlusten. Private Klinikketten „beherrschen“ die notwendigen Rationalisierungen besser als kommunale Krankenhausträger.
Da die Tarifsteigerungen somit regelmäßig über den Vergütungssätzen liegen, führt dies zu entsprechend geringeren Gewinnmargen oder gar zu Verlusten. Private Klinikketten „beherrschen“ die notwendigen Rationalisierungen besser als kommunale Krankenhausträger.
Strukturen, Leistungsumfang und Prozesse prüfen, Kapazitäten besser einsetzen, Vorhaltekosten senken – davon profitieren auch die Patienten.
Folgt dieser Kosten-Preis-Schere die Qualitätsschere?
Ziel im Sinne der Patientenorientierung muss die Sicherstellung einer flächendeckenden Mindest-Ergebnisqualität sein, die von einem neutralen Dritten kontrolliert wird und bei Abweichungen spürbare monetäre Auswirkungen hat.
Die Bund-Länder-Kommission nimmt einen neuen Anlauf, die Voraussetzung für das Budget auf Basis einer nachweisbaren Ergebnisqualität zu schaffen.
Dies wurde bereits 1997 von der Konferenz der Gesundheitsminister beschlossen und wird nun nach 18 Jahren hoffentlich volljährig und umgesetzt.
Die Ergebnisqualität bezieht sich immer auf das Behandlungsergebnis. Wichtig ist dabei die Patientenzufriedenheit. Sie muss von neutralen Instanzen nach den medizinisch fundierten Qualitätsindikatoren des GBA gemessen und bewertet werden. Zudem sollten die neutralen Instanzen die Patienten systematisch befragen, die Antworten auswerten und die Ergebnisse veröffentlichen.
In Ballungsgebieten wird dies besser zu gewährleisten sein, etwa durch Bündelung von Leistungsschwerpunkten und Kooperationen. Im ländlichen Raum ist dies nicht durchgängig möglich.
Die rückläufigen Fördermittel gehen zu Lasten der Substanz und fehlen als entscheidendes Mittel für Effizienzverbesserungen in den Krankenhäusern.
Dies zwingt geradezu alle Beteiligten, als Alternative zur Privatisierung zu stärkeren Verbundlösungen zu gelangen und zur konsequenten Abkehr von Besitzstandsansprüchen.
Hierdurch können Prozess- und Ergebnisqualität verbessert und geringere Strukturkosten erreicht werden.
Eine Hilfestellung eines spezialisierten Beratungsunternehmens kann dabei sinnvoll sein.Um aber die stationäre Patientenversorgung auf Dauer auf einem hohen Niveau zu halten, müssen klare politische Ziele formuliert und kontrolliert werden.
Dabei muss wieder gelten: das oberste Ziel eines Krankenhauses ist die verlässliche Versorgung der stationären Patienten und nicht Gewinnmaximierung um jeden Preis.
Das Unternehmensziel, „nur Geld zu verdienen“ ohne Einbeziehung der Ergebnisqualität, gehört auf den Prüfstand und darf nicht weiter um sich greifen zu Lasten der Patientenversorgung und des Personals.
Die Wahl der richtigen Therapie hängt davon ab, die richtigen Dinge zu tun (Effektivität) und sie richtig umzusetzen (Effizienz), nicht gegen die Mitarbeiter sondern mit ihnen.
Dann ist der Patient „Krankenhaus“ wieder auf dem Wege der Besserung – zum Nutzen und zum Wohle des Patienten „Mensch“.
Autor dieses Artikels:
Heinz-Otto Nagorny, Geschäftsführender Gesellschafter, HONAGO Consulting GmbH
Den Autor erreichen Sie über medemus.
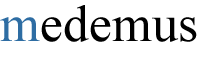


Bei seiner jahrzehntelangen Beratungs- und Leitungstätigkeit in der Gesundheitswirtschaft hat Herr Nagorny ganz offensichtlich gelernt, „über den Tellerrand zu schauen“ und dabei die Erkenntnisse und Erfahrungen der freien Wirtschaft mit den Interessen der kommunalen, frei gemeinnützigen und privaten Krankenhäuser zu kombinieren. Unbedingt zuzustimmen ist ihm deshalb bei der Feststellung, dass Jammern über die chronische Unterfinanzierung im Gesundheitswesen nicht hilft und dass private Klinikketten die notwendigen Rationalisierungen besser „beherrschen“ als kommunale Krankenhausträger.
Auch bei seiner Feststellung, dass die Patienten langfristig von einer Verbesserung der Struktur- und Prozessqualität profitieren, kann man dem Autor sicherlich zwanglos folgen. Unstrittig ist die Ergebnisqualität hinsichtlich der Beurteilung des Behandlungserfolges für Patienten und Kostenträger das wichtigste Prüfkriterium. Dass 18 Jahre nach dem Beschluss der Konferenz der Gesundheitsminister durch die Bund-Länder-Kommission etwas Bewegung in die Finanzierung des Gesundheitswesens kommt, ist gewiss zu begrüßen. Die „Abkehr von Besitzstandansprüchen“ erscheint dem Autor zu Recht als positiver Effekt bei der möglichen Verknappung von finanziellen Mitteln durch die künftige Abhängigkeit der Finanzierung von der Behandlungsqualität.
Es bleiben jedoch nach meinem Dafürhalten in dem Artikel einige wichtige Aspekte des Zusammenhangs zwischen defizitärer Finanzierung des Gesundheitswesens und Behandlungsqualität unkommentiert, die ich gerne in einem weiteren Beitrag noch etwas ausführlicher darstellen möchte.
Auf dem Weg zu „Ankreuz-Medizin“
Die Erkenntnis, dass Jammern über die chronische Unterfinanzierung des Gesundheitswesens den Krankenhäusern nicht hilft und mehr Geld nicht zu erwarten ist, teile ich voll und ganz mit Herrn Nagorny. Auch die Beobachtung, dass private Klinikketten mit den Folgen dieser Entwicklung besser umgehen können als kommunale Krankenhausträger, scheint eher logisch als überraschend, da innerhalb dieser Gruppierungen ganz andere Möglichkeiten der Rationalisierung durch Zentralisierungen und Mischkalkulationen im eigenen Klinikverbund bestehen. Externe Experten vermögen insbesondere im Bereich von kleinen und mittleren Krankenhäusern die vorhandenen Potentiale zu ermitteln und kostengünstig wie auch liquiditätswirksam zu erschließen.
Die im Beitrag zum Wohl der Leistungserbringer und Patienten vorgeschlagene Verbesserung der kontinuierlichen Prüfung von Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität, ist sicherlich sinnvoll. Alle Überlegungen und Aktivitäten, die dabei helfen, aus dem in den meisten Krankenhäusern noch anzutreffenden „Papiertiger Qualitätsmanagement“ ein von allen MitarbeiterInnen aktiv gelebtes Managementprinzip und Geschäftsmodell zu machen, sind begrüßenswert. Dennoch kann die präzise und vollständige Übertragung allgemein gültiger ökonomischer Regularien auf das Gesundheitswesen kann nicht gelingen, da hier in gewissem Umfang eigene Regeln gelten.
Zunächst ist als Besonderheit des Gesundheitssektors festzuhalten, dass jede im Bereich der gesetzlichen Krankenversorgung angebotene Leistung auch von Patienten nachgefragt wird. Insofern ist ein wirksamer Regeleffekt über eine wie auch immer gestaltete Reduzierung der Nachfrage nicht zu erwarten. Folgerichtig ist daher, die Ergebnisqualität als Prüfkriterium heranzuziehen, wenn bei Abweichungen von einem Mindest-Standard für den Leistungserbringer über monetäre Auswirkungen eine steuernde Wirkung erzielt werden soll. Wie die medizinischen Standards für diese Behandlungsergebnisse zu formulieren sein werden, dürfte in naher Zukunft Gegenstand intensiver Diskussionen sein. Voraussetzungen für eine zuverlässige Kontrolle sind einerseits der zweifelsfreie Nachweis der Ergebnisqualität und andererseits die nachvollziehbare Prüfung der Patientenzufriedenheit mit einem geeigneten Instrumentarium.
Eine gewisse Skepsis gegenüber der Hoffnung von Herrn Nagorny auf eine zuverlässige, flächendeckende Überprüfung der Ergebnisqualität muss jedoch erlaubt sein. Schon einmal wurde mit dem MDK eine Institution geschaffen, deren Sinn und Zweck darin bestehen sollte, die Richtigkeit und Plausibilität medizinischer Leistungen und der damit verbundenen Dokumentation als unabhängige medizinische Instanz zu überprüfen. In der Zwischenzeit jedoch ist der Medizinische Dienst der Krankenkassen zum verlängerten Arm der Kostenträger verkommen. Seine Aufgabe besteht inzwischen vorwiegend darin, den Krankenkassen bei der Abrechnung teurer medizinischer Leistungen durch oftmals pseudomedizinische Schein-Argumente und sog. sozialmedizinische Gutachten eine Basis für die Verweigerung der Kostenübernahme zu schaffen. Angesichts rapide dahinhinschmelzender Budgets wurden von den Leistungserbringern in den letzten Jahren zunehmend hilfesuchend die zuständigen Gerichte eingeschaltet, die sich dieser Problematik ausführlich angenommen haben und die unerschöpfliche Kreativität der Kostenträger zumindest kanalisieren.
Die Schwierigkeiten, die mit einer objektivierbaren Feststellung der Ergebnisqualität beim Patienten durch die notwendigen Befragungen einhergehen würden, wären sicherlich immens. Aller Wahrscheinlichkeit nach würde deshalb die Leistungsdokumentation beim Leistungserbringer selbst ein wesentlicher Teil des Nachweises über die Leistungserbringung sein. Medizinische Behandlungspfade und alle erdenklichen Varianten der Dokumentation des klinischen Behandlungsverlaufs existieren bereits in der Praxis. Sie wären bei der Prüfung der Ergebnisqualität und dem Vergleich der Behandlungsergebnisse zweifellos die geeigneten Instrumente zur objektiven Feststellung von Effektivität und Effizienz gleichermaßen.
Der Umfang der Dokumentation, die in den klinischen Alltag Einzug gehalten hat, ist immens und seine medizinische Notwendigkeit für den Kliniker kaum noch nachvollziehbar. Dabei haben viele Instrumente zur Dokumentation von medizinischen Leistungen den Charakter von eher zweifelhaften qualitätssichernden Maßnahmen, deren Pflege nur auf Druck der Kostenträger betrieben wird, ohne dass für den damit verbundenen Mehraufwand jemals eine Vergütung stattfindet.
Unter dem Deckmantel der Qualitätssicherung wurden den Kliniken in den letzten zwei Jahrzehnten von den Kostenträgern ungeheure Erlösverluste zugemutet. Mit dem geradezu genialen Schachzug der Krankenkassen, dass Krankenhaus-Leistungen, nämlich die medizinisch notwendigen Maßnahmen, nur unter bestimmten, von den Kostenträgern festgelegten Qualitätskriterien erbracht werden dürfen, ist der Vergütungswillkür geradezu Tür und Tor geöffnet. Sind demnach nicht alle medizinischen Leistungen dokumentiert, die einem Leistungskomplex entsprechen, so ist dieser nicht vollständig erbracht und wird nicht vergütet. Werden hingegen mehr Leistungen dokumentiert als gefordert, so waren diese nach Kassen-Lesart medizinisch nicht notwendig und müssen auch nicht bezahlt werden. Regelmäßige Kodierprüfungen durch externe Profis können dabei schlimme Überraschungen vermeiden helfen.
Aus dieser genannten, weiteren Besonderheit des Gesundheitssystems, dass nämlich der Kostenträger selbst in weiten Grenzen bestimmen kann, welche Leistungen er vergütet und welche nicht, ergibt sich für die Frage von Herrn Nagorny, ob auf die „Kosten-Preis-Schere“ auch eine „Qualitätsschere“ folgt, eine bittere Konsequenz, auf die in seinem Artikel aber nicht weiter eingegangen wurde. Dabei wird es gerade für die Krankenhäuser besonders schwer, die, wie es der Autor nannte, als oberstes Ziel „die verlässliche Versorgung der Patienten hatten und nicht die Gewinnmaximierung um jeden Preis“. Denn gerade dort wird, nach der vollständigen Ausschöpfung aller Rationalisierungsmöglichkeiten durch den eigenen hohen Anspruch an die Qualität der Patientenversorgung, der finanzielle Druck unerträglich.
Die Folge dieser Entwicklung besteht dann nämlich in der flächendeckenden Etablierung einer „qualitätsgesicherten Ankreuz-Medizin“, bei der die Freiheit der ärztlichen Behandlungskunst aufgegeben werden muss. An ihre Stelle tritt ein Behandlungsregime, bei dem zu einer bestimmten Diagnose nur noch die Behandlungsleistung erbracht werden darf, die im jeweiligen Behandlungspfad, gleich einer Checkliste, vorgegeben ist, weil diese Leistung von den Kostenträgern gefordert und damit auch als einzige sicher vergütet wird. Dass sich dieser Behandlungsablauf aus den im Rahmen der „Qualitätssicherung“ preisgünstigsten und nicht den medizinisch besten Komponenten zusammensetzen wird, darf dann wohl wirklich als „gesichert“ gelten. Für die negativen Auswirkungen dieser Entwicklung auf die Ergebnisqualität und die Patientenzufriedenheit werden sicherlich wieder die Krankenhäuser allein verantwortlich gemacht werden, denn die Kassen hatten ja vermeintlich wieder einmal nur die Sicherung der Behandlungsqualität für ihre Versicherten im Auge.
Es erscheint daher entgegen der Sichtweise von Herrn Nagorny naheliegender, dass der Kostendruck durch die sich anbahnenden Veränderungen weiter steigen wird und die beruflichen Belastungen trotz intensiver Bemühungen für alle Leistungserbringer ohne Ausnahme zunehmen. Keineswegs werden also nur die „Gewinn-Maximierer mit Besitzstandansprüchen“ am Gesundheitsmarkt den steigenden Druck zu spüren bekommen. Der Einsatz externer Experten kann in solch einer angespannten Situation nicht nur der Erlössicherung, sondern sogar der Existenzsicherung dienen.
Von der großen Öffentlichkeit völlig unbemerkt, hat durch die Kostenträger schon längst eine Umlenkung der Patientenströme in die Krankenhäuser und Kliniken begonnen, die die jeweilige Behandlungsleistung „qualitätsgesichert“ am preisgünstigsten zu erbringen vermögen. Vorzugsweise sind dies zumeist die Krankenhäuser, deren Einsparpotentiale sich aus der schon angesprochenen Zugehörigkeit zu Klinikketten ergeben. Ganz geschickt wird dafür vom MDK ein neues, mit der Einführung des DRG-Systems vom Gesetzgeber im Krankenhausfinanzierungsgesetz geschaffenes Instrument genutzt, nämlich der § 17c KHG, mit dem ursprünglich sichergestellt werden sollte, dass keine Fälle ins Krankenhaus aufgenommen werden oder dort verbleiben, die keiner stationären Behandlung bedürfen. Ein wesentlicher Prüfparameter für die Ermittlung dieser „Fehlbelegungen“ ist natürlich die Kodierung, bei der für die Kliniken im Vorfeld der MDK-Prüfung, häufig nur mit externem Expertenwissen, ein nachhaltiger Schutz gegen willkürliche Erlösminderungen durch die Kostenträger aufgebaut werden kann.
Und abschließend bemerkt wird sich auch der Trend zu „blutigen Entlassungen“ unter diesen DRG-Bedingungen zu Lasten der Rehabilitationskliniken und der Versorgungsqualität insgesamt weiter verstärken und die Gesamtsituation zwangsläufig verschlimmern (Zu den Folgen s. auch die Prognos-Studie: Die medizinische Rehabilitation Erwerbstätiger – Sicherung von Produktivität und Wachstum).